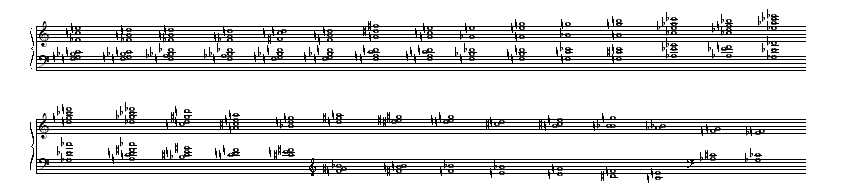
von Wolfgang Fulda
Allgemeines - Gesamtplan - Farben - Rhythmus - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - Zusammenfassung
Zu den kammermusikalischen Meilensteinen des 20. Jahrhunderts zählt zweifellos Olivier Messiaens Quatour pour la Fin du Temps. Knapp 60 Jahre nach der Uraufführung taucht es vergleichsweise häufig in ganz unterschiedlichen Konzertprogrammen - nicht nur der explizit Neuen Musik - auf. Seine eigentümliche Atmosphäre teilt sich dem aufgeschlossenen Hörer unmittelbar und eindringlich mit, die Fülle der versammelten Gedanken, Vorstellungen und Bilder, die Komplexität von musikalischer Gestalt und Technik lohnen genaue Betrachtung. 1946 - 5 Jahre nach der Uraufführung des Quartetts für das Ende der Zeit - antwortet Messiaen in der Zeitschrift Contrepoints auf die Frage nach seinem Selbstverständnis als Komponist:
… Ich habe versucht, ein christlicher Musiker zu sein und meinen Glauben zu singen, ohne dass es mir je gelungen wäre … Absolute Musik, profane Musik und vor allem theologische (und nicht, wie die Mehrheit meiner Hörer meint, mystische) Musik wechseln in meinem Schaffen ab. Ich weiß wirklich nicht, ob ich eine "Ästhetik" habe, aber ich kann sagen, dass meine Vorliebe einer schillernden, raffinierten, ja wollüstigen (aber natürlich nicht sinnlichen!) Musik gilt. Einer Musik, die singt … Einer Musik, die ein neues Blut, eine zeichenhafte Geste, ein unbekannter Duft, ein Vogel ohne Schlaf sein soll. Einer Kirchenfenster-Musik, einem Kreisen von komplementären Farben. Einer Musik, die das Ende der Zeit, die Allgegenwart, die verklärten Leiber und die göttlichen wie übernatürlichen Mysterien ausdrückt. Einem 'theologischen Regenbogen' … [1]
Wesentliche Koordinaten des gesamten Messiaen’schen Schaffens, auch dem der späteren Jahre, sind hier benannt. Dass diese uneingeschränkt auch oder gerade in einem Werk zu Tage treten, das unter den widrigsten äußeren Bedingungen entstand, unterstreicht ihre Bedeutung, verleiht ihnen besondere Glaubwürdigkeit. An die Uraufführung erinnert sich Messiaen 1978 im Gespräch mit dem Journalisten Claude Samuel:
… sie fand in Görlitz, Schlesien, bei bitterer Kälte statt. Das Stalag war unter einer tiefen Schneedecke versunken. Wir waren 30.000 Gefangene (zumeist Franzosen, aber auch einige Polen und Belgier). Die vier Interpreten spielten auf kaputten Instrumenten: Das Violoncello von Etienne Pasquier hatte nur drei Saiten und die Tasten meines Pianinos blieben stecken. Unglaublich auch unser Gewand: Man hatte mich mit einer grünen, völlig zerissenen Jacke ausstaffiert, und ich trug Holzpantoffeln. Die Zuhörerschaft setzte sich aus allen sozialen Schichten zusammen: Priester, Ärzte, Kleinbürger, Berufssoldaten, Arbeiter und Bauern. [2]
Der Not der äußeren
Umstände entsprungen ist die eigentümliche Besetzung für Violine,
Klarinette, Violoncello und Klavier: sie ergab sich aus den im Lager zufällig
vorhandenen Instrumenten und Solisten. Der IV. Satz Interméde,
ein Trio noch ohne Klavier, stand dabei offenbar am Anfang. In der Gesamtanlage des
Quartetts zeigt sich nun aber ein genau kalkulierter, ökonomischer Umgang mit der
notgeborenen Besetzung: jedes Instrument spielt in sechs Sätzen. Alle
vier Instrumente spielen dabei allerdings nur in vieren der insgesamt acht
Sätze zusammen (in den Sätzen I, II, VI und VII), daneben gibt
es ein Solo für die Klarinette (III. Satz), zwei Duos (die beiden
Lobpreisungen: Klavier und Violoncello im V. Satz, sowie Klavier und Violine im letzten
Satz) und das schon erwähnte Trio. Gerade das Enden des Zyklus in
einem fragilen, weil unendlich langsamen Duo zeigt Messiaens völliges
Desinteresse an einer auf äußeren Effekt abzielenden, wirkungsvollen
Dramaturgie - im Gegenteil: die Gesamtform steht ebenso wie jedes Detail
im Zusammenhang mit der im Werktitel formulierten Vision von Zeitenende
und Ewigkeit. Die im Vorwort zur Partitur von Messiaen angeführten
Verse aus dem X. Kapitel der Offenbarung des Johannes spannen den Rahmen auf:
Ich sah einen starken Engel vom Himmel herabsteigen, mit einer Wolke bekleidet, ein Regenbogen auf seinem Haupt … Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde … und erhob, aufrecht über Meer und Erde, seine Hand gen Himmel und schwor bei Dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit … es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern am Tage der Posaune des siebten Engels wird sich das Geheimnis Gottes erfüllen …
Schon immer in seiner fast zweitausendjährigen Wirkungsgeschichte hat dieser Text spektakuläre Assoziationen geweckt (man denke nur an die Reihe der Dürer’schen Holzschnitte). Apokalypse als Horror mag wohl den Insassen eines Gefangenenlagers zur unmittelbaren Erfahrung werden. Das Eigentümliche bei Messiaen jedoch: beinahe unabhängig von der äußeren Situation stoßen die Verse ihn ins Erleben sehr grundlegender Phänomene hinein, die ihn als gläubigen Menschen wie als Musiker betreffen. Äußerungen dieses Erlebens sind nur möglich als Versuch und Stammeln, die Satztitel bleiben daher oft rätselhaft und mehrdeutig in ihrem Kontext - vergleichbar vielleicht eingeklammerten Titeln am Ende von Claude Debussy’s Préludes für Klavier? Die sich daraus ergebende Gesamtform ist also keinesfalls mit Programmmusik zu verwechseln:
Zunächst das Erlebnis des Engels, das sich in den Sätzen II und VII gleichsam als symmetrischer Klammer niederschlägt: der Engel und sein Wort (als quasi gregorianischer Gesang), der Engel und der Regenbogen. Dem, worauf der Engel hinweist, Jesus, widmen sich die beiden Duos: dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit der V. Satz, der Seele, der sich in Jesus das Geheimnis Gottes erfüllt, der VIII. Satz, in je einer unendlich langsamen Melodie in E-Dur. Zu Beginn eröffnet der I. Satz den Raum des Universums - Himmel, Meer, Erde: Vogelstimmen entfalten sich über zwei verschiedenen Ostinatobewegungen. Der Klang der Posaune des siebten Engels, sein Schwur bricht sich Bahn im wütenden Unisono des VI. Satzes. Der Abgrund der Verlassenheit und die Vorahnung des Endes der Zeit stehen als Bilder hinter der Musik der Sätze III und IV. Warum gerade acht Sätze? Messiaen in seinem Vorwort lapidar:
Sieben ist die perfekte Zahl, die Schöpfung in sechs Tagen geheiligt durch den göttlichen Sabbat; die 7 dieses Ruhetages verlängert sich in der Ewigkeit und wird die 8 des unvergänglichen Lichtes, des unerschütterlichen Friedens. [3]
Messiaen "Quatour pour la Fin du Temps"
- Gesamtform -
| Satz | I Liturgie de cristal |
II Vocalise, pour l'Ange qui annonce la Fin du Temps |
III Abîme des oiseaux |
IV Intermède |
V Louange à l'Éternité de Jésus |
VI Danse de la fureur, pour les sept trompettes |
VII Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la Fin du Temps |
VIII Louange à l'Immortalité de Jésus |
| theologischer Begriff | Universum Vielfalt der Bewegungen |
Engel Regenbogen |
Natur Verlassenheit des Daseins | Ahnung | Jesus göttliche Liebe | Wut Raserei Begeisterung |
Engel Regenbogen |
Jesus als Mensch Aufstieg zu Gott |
| musikalische Elemente | Vogelstimmen Ostinati Kirchenfenster- wirkung | Gregorianik Komplementärfarben Carillon |
Klagegesang Vogelstimmen | Trio in klassischem Kontrapunkt E (Dur) |
unendlich langsame Melodie in E-Dur | Unisono rhythmische Projektionen Katalysator |
Gregorianik Komplementärfarben Skalengewirr |
unendlich langsame Melodie in E-Dur |
| musikalische Form | A - B - A' | A - B - A' | entwickelnde Variation | entwickelnde Variation | ||||
| Besetzung | Vl Klar Vc Kl |
Vl Klar Vc Kl |
Klar |
Vl Klar Vc |
Vc Kl |
Vl Klar Vc Kl |
Vl Klar Vc Kl |
Vl Kl |
Neben der an gregorianischen Gesten orientierten, häufig modalen Melodik hebt Messiaen die Möglichkeiten der Harmonik als unerschöpflicher Quelle der Farbigkeit hervor. So lässt sich aus der Verbindung verschiedener vielstimmiger Akkorde eine Art Kirchenfensterwirkung erzielen. In den späteren Orchesterwerken (etwa in Couleurs de la Cité celeste) finden sich Farbangaben sogar explicit in der Partitur. 1978 sagt er in Paris dazu:
… die Farbenmusik aber bewirkt, was die Glasfenster und Rosetten des Mittelalters bewirken: Sie führt uns zum Geblendetsein. Sie spricht unsere vornehmsten Sinne an, das Gehör und das Auge, und sie bewegt zugleich unsere Sensibilität, reizt unsere Vorstellungskraft, steigert unsere Intelligenz und leitet uns an, unsere Begriffswelt zu überwinden, uns dem zu nähern, das über dem logischen Denken und der Intuition angesiedelt ist, nämlich dem Glauben. [4]
Derartige Synästhesien finden sich etwa in den 29 Akkorden, die das klangliche Material des Klavier-Ostinatos im I. Satz bilden:
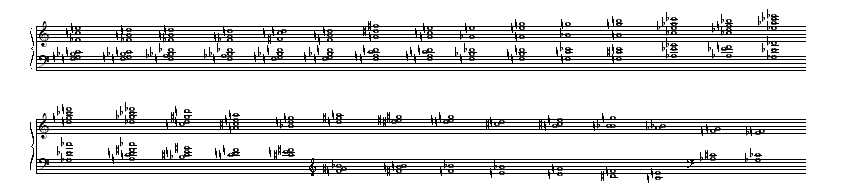
In erster Linie aber geht es um die Zeit und damit um Rhythmus. Ohne weiteres lassen sich die folgenden Bemerkungen Messiaens anläßlich der Verleihung des Erasmus-Preises 1971 auf das Quartett beziehen:
Ich liebe vor allem die Zeit, denn sie ist der Beginn der gesamten Schöpfung … die Zeit macht, daß wir die Ewigkeit im Kontrast verstehen. Die Zeit müßte der Freund aller Musiker sein … der Musiker besitzt eine geheimnisvolle Kraft: er kann, durch seine Rhythmen, die Zeit hier und da zerteilen und sogar rückwärts laufen lassen, fast so, als bewege er sich an verschiedenen Punkten der Zeitdauer fort oder als sammle er die Zukunft dadurch, daß er sich der Vergangenheit zuwendet, und als ob die Erinnerung an die Vergangenheit sich verwandle in eine Erinnerung an die Zukunft.[5]
Aus diesem Grund fügt er seinem Vorwort eine kleine Rhythmuslehre hinzu: die dort erläuterten hinzugefügten Werte, Augmentation und Diminution, nicht umkehrbaren Rhythmen und andere Formen werden zu Elementen einer rhythmische Sprache, deren Gegensatz zur gewohnten westlichen Tradition einer Ausführung nicht unbeträchtliche Hürden entgegenstellt. Setzen sich doch Messiaens rhythmische Gestalten - der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Rhythmus als einem Fließenden folgend - nicht aus Takten, sondern aus der freien Addition verschiedener Werte zusammen. Entsprechend erscheint die Notation: zwar konventionell im Notenbild, aber komplex - einerseits die gewohnten Taktbezeichnungen, aber ohne erkennbare Beziehung zum jeweiligen rhythmischen Inhalt - andererseits permanente Wechsel von völlig offenen nicht bezeichneten Takten, die jedoch genau auszuführen sind. Die Vielfalt der Zeit findet darüberhinaus Ausdruck in extremen Tempi: in der rasenden Danse de la fureur mit Achteln = 176, wie im Gegensatz dazu in der Louange (V. Satz) mit dem außerordentlich langsamen Sechzehntelpuls von 44. Der Komponist 1958:
Vergessen wir nicht, dass das Urelement, das essentielle Element der Musik der Rhythmus ist, und dass der Rhythmus vor allem Wechsel von Zahl und Dauer bedeutet. Stellen wir uns einen einzigen Schlag im gesamten Universum vor. Ein Schlag: die Ewigkeit davor, die Ewigkeit danach. Ein Davor und ein Danach, das ist die Geburt der Zeit. Stellen wir uns, gleich darauffolgend, einen zweiten Schlag vor. Da sich jeder Schlag in der darauffolgenden Stille fortsetzt, wird der zweite Schlag länger dauern als der erste. Eine andere Zahl, eine andere Dauer, das ist die Geburt des Rhythmus … [6]
Hinter den Hürden aus komplexer Partitur
und technischen Schwierigkeiten erscheinen Gedanke wie Musik in großer
Einfachheit und Klarheit: Ende der Zeit technisch - Ende der Voherrschaft
von Takt und Metrum, stattdessen eine kurze Dauer und ihre freie Multiplikation;
Ende der Zeit theologisch - Ende von Vergangenheit und Zukunft, der Wunsch nach
ewiger Gegenwart.
Die große Bedeutung Messiaens für die Entwicklung der seriellen Musik nach 1945 wird im I. Satz, kristallene Liturgie deutlich: Stetig durchläuft die Klavierstimme die Reihe (also "Serie") der schon erwähnten 29 Kirchenfensterakkorde und folgt dabei den Tondauern eines pédale rythmique, eines großen Ostinato-Rhythmus. Dieser besteht aus einer Serie von 17 Tondauern, die sich aus der Verkettung dreier indischer Rhythmen ergeben: râgavardhana (in freier Umformung - mit den in Sechzehnteln gemessenen Wertigkeiten 4-4-4-2-3-2), candrakalâ (mit den Wertigkeiten 2-2-2-3-3-3-1) und laksmiça (mit den Wertigkeiten 2-3-4-8). Die Überlagerung zweier ungleicher Reihen - die 29 Akkorde werden im Verlauf des Satzes etwa fünfeinhalbmal, die 17 Tondauern des pédale rythmique neuneinhalbmal wiederholt - führt zu einem geheimnisvollen Irisieren der Farbwerte, zu klanglichem Staub, wie Messiaen im Vorwort schreibt.
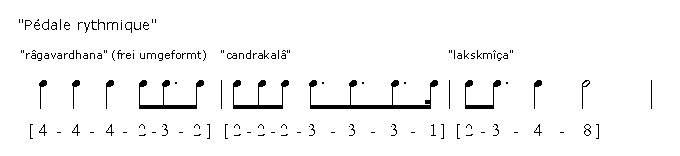
Ein großes Ostinato auch in der Violoncellostimme: die 5 Töne c - e - d - fis - b werden in einer Reihe von 15 Tondauern dreimal wiederholt. Diese entsteht aus der Kombination zweier nicht umkehrbarer Rhythmen - gemeint sind symmetrische Rhythmen, die vorwärts wie rückwärts gelesen die gleiche Gestalt ergeben - (mit den in Achteln gemessenen Wertigkeiten 4-3-4 und 4-1-1-3-1-1-1-1-3-1-1-4). Während Messiaen die Instrumente im Quartett allgemein eher in ihren traditionellen Möglichkeiten einsetzt, nutzt er hier zu Beginn eine avantgardistische Spieltechnik: die Verbindung künstlicher Flageoletts mit langsamen Glissandi. Unwillkürlich denkt man dabei an den Klang der Ondes Martenot, eines elektronischen Musikinstruments, das in Frankreich seit 1928 und insbesondere von Messiaen gerne und häufig eingesetzt wird.
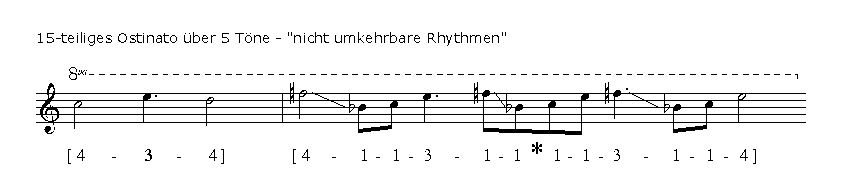
Siebeneinhalbmal kehrt diese nicht umkehrbare, ungreifbar-kreisende Bewegung im Verlauf des Satzes wieder, ähnlich vielleicht dem, was der Astronom Johannes Kepler im fünften Buch seiner Harmonices Mundi über die Melodien der Planetenbahnen mitteilt … Zu diesen Bewegungen des anorganischen Universums treten nun zwei Stimmen der belebten Welt: die Violine spielt mobileartig mit vier fixierten Patterns einer stilisierten Amsel, während die Klarinette Girlanden und Triller einer imaginären Nachtigall quasi frei improvisiert. Mit seriellen Methoden wird so ein Raum geschaffen, in dem verschiedene Vorgänge in völliger Unabhängigkeit stattfinden, ganz jeweils eigenen Bewegungsgesetzen, eigenen Zeiten folgend. Vorstellungen wie die Himmelsmechanik der mittelalterlichen Kristallsphären, aber auch Analogien zu molekularen Kristallbildungsprozessen liegen nahe. Messiaen dazu 1958:
… all die übereinandergeschichteten Zeiten, die uns umgeben: die ungeheuer lange Zeit der Sterne, die sehr lange Zeit der Berge, die mittlere des Menschen, die kurze Zeit der Insekten, die ganz kurze Zeit der Atome: all diese Zeiten sind insofern ähnlich, als sie für jede Einheit eine normale Lebensdauer bedeuten; doch stellen sie im Gegensatz dazu eine enorme Schwierigkeit für unsere Wahrnehmungsfähigkeit dar … die verschiedenen Zeiten, die im Menschen zusammenleben: die physiologische Zeit, die psychologische Zeit … 7]
Die musikalische Form des II. Satzes, Gesang des Engels, der das Ende der Zeit ankündigt folgt in ihrer Dreiteiligkeit der Vision: Erscheinung des Engels - Botschaft - Entschwinden. Im 1. Teil wird mit der Wucht der Schritte deutlich, was Rainer Maria Rilke mit dem bekannten Anfang der zweiten Duineser Elegie von 1912 zum Ausdruck zu bringen versucht: Jeder Engel ist schrecklich …
Das Hauptgewicht des Satzes liegt auf der Botschaft des Engels.
Mit der Spielanweisung fast langsam, ungreifbar, entfernt führen
Violine und Violoncello mit Dämpfer einen gleichsam gregorianischen Gesang
im Doppeloktavabstand aus. Diese ungeheuer weit gespannten Phrasen entfalten sich
ihrerseits gemäß einem dreiteiligen A-B-A’-Schema.
Wesentliche Formelemente des Gregorianischen Chorals sind hierbei übernommen,
so das Initium as-c, eine Art Tenor as, die Finalis d. Das Tonmaterial entstammt
dem Messiaen’schen 3. Modus. Die frei fließende Rhythmik enthält
hinzugefügte Werteebenso wie verkürzte Werte:
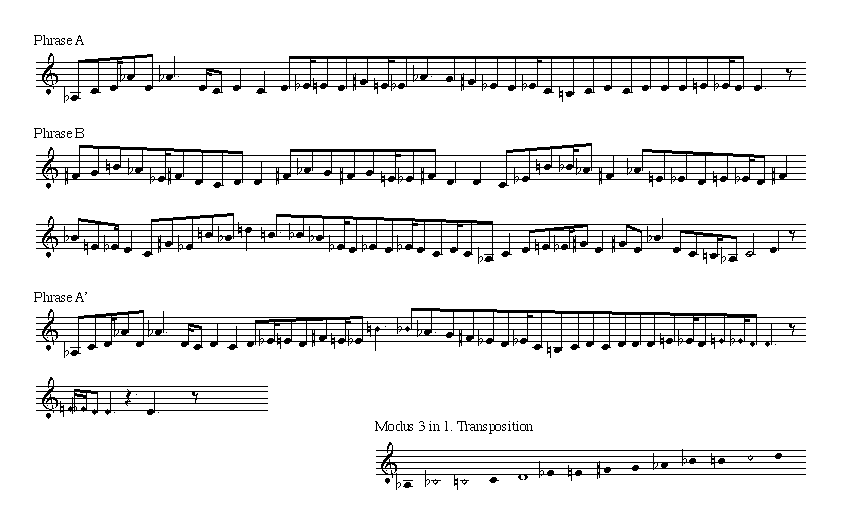
Die begleitende Klavierstimme enthält den erläuternden Zusatz Wassertropfen im Regenbogen, im Vorwort ist die Rede von Kaskaden blau-orangener Akkorde, von fernem Geläute - französisch carillon,das sich als feststehende musikalische Gestalt in vielen Werken Messiaens findet. Das Entschwinden des Engels ist musikalisch umgesetzt als Umkehrung des eröffnenden Teils. Bezüglich der Skalenabstürze, Trillerflächen und Klangreflexe spricht Messiaen vom Wetterleuchten des Heiligen (fulgurance du Sacré). Hingewiesen sei auf ein bemerkenswertes Detail: die furchteinflößende Erscheinung zu Beginn enthält den sich dann so breit entfaltenden "gregorianischen Gesang" bereits in nuce. Komprimiert zu einer rasenden Sechzehntelkette blitzt er als Substanz des Engels jäh auf.
Im III. Satz - rätselhaft mit Abgrund der Vögel überschrieben - fällt neben einer langgezogenen Klagemelodie und Elementen der Vogelimprovisation des I. Satzes besonders ein dreimal wiederkehrender Ton auf. Gleichsam ein Ton des Abgrunds, aus dem Nichts auftauchend und langsam zu höchster Intensität aufschwellend.
Ausgehend von einer konventionellen
8-taktigen Periode mit Vorder- und Nachsatz im Unisono auf E werden im IV. Satz -
Zwischenspiel - in klassisch thematischer Arbeit verschiedene Gedanken behandelt:
neben der bereits bekannten Vogelstimme der Klarinette aus dem I. Satz eine Vorwegnahme
der Melodie A des VI. Satzes. Die Gesamtform ist wieder dreiteilig A-B-A’.
Der Schluß in E-Dur leitet zum V. Satz hin.
Hier - die erste der beiden Louanges - greift Messiaen Elemente einer vier Jahre zurückliegenden Komposition für 6 Ondes Martenot - Fête des belles eaux - auf. In einer E-Dur-Umgebung aus überwiegend reinen Dreiklängen schwebt die Violoncello-Melodie des V. Satzes, dem Lobpreis der Ewigkeit Jesu. Gemäß dem Prinzip der entwickelnden Variation entwachsen dem melodischen Anfangsmotiv immer neue Formen. Entscheidend bleibt aber hier das Tempo, das mit den bereits erwähnten 44 Sechzehnteln pro Minute die Grenze des menschlichen Maßes der Langsamkeit überschreitet und damit in eine völlig neue Zeitdimension vordringt. Der Musikwissenschaftler Aloyse Michaely schreibt dazu:
Den Stillstand, das Ende der Zeit suggeriert Messiaen häufig durch die Verwendung von ungewöhnlich langsamen Tempi: "… etwas Orientalisches in meiner Musik … das gibt es nicht in Europa … einen Europäer bringt das aus der Fassung …"[8]
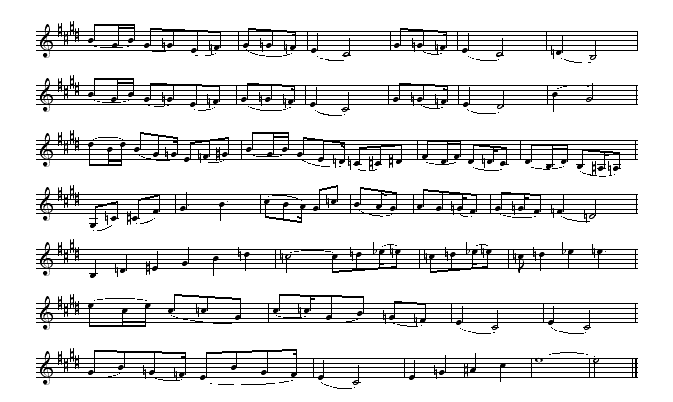
Vergleichbare Versuche der Erforschung extrem langsamer Tempi findet man sonst nur bei Gustav Mahler - man denke etwa an die Symphonie Nr. IV in G-Dur mit ihrem III. Satz Ruhevoll - oder in der Musik Morton Feldmans. Allerdings stellte auch in der alten Musik vor 1600 das bewußte Verlangsamen des Pulses durch die Wahl eines Grundschlags um ca. 50 eine Methode dar, den Geist zur Ruhe zu bringen und ihn für die göttlichen Einflüsse zu öffnen.[9]
Radikal unterscheidet sich der VI. Satz - deutsch etwa Tanz der Wut für die sieben Posaunen - von den übrigen Sätzen des Zyklus durch seine konsequente Einstimmigkeit. Fureur bedeutet im Französischen neben Wut auch noch Raserei und Begeisterung. Dem entspricht die tritonushaltige Melodie A mit ihrer bizarren Dauernfolge. Im weiteren Verlauf nimmt die Intensität der fureur zu: dieselbe Melodie wird ihrer rhythmischen Kontur beraubt und zu einem Strom unterschiedloser Sechzehntel komprimiert. Zuletzt, auf dem energetischen Höhepunkt, lösen sich die einzelnen Melodietöne aus ihrem Zusammenhang und springen auf andere Oktavräume über - die Melodie wird also aufgespreizt und dabei rhythmisch gedehnt. Messiaen im Gespräch mit Claude Samuel 1986:
… rhythmisch ist eine Musik, die die Wiederholung, das Ebenmaß und die gleichen Unterteilungen meidet, die im ganzen genommen inspiriert ist von den Bewegungen in der Natur, Bewegungen von freier und ungleicher zeitlicher Dauer … die Klassiker … sind schlechte Rhythmiker oder vielmehr Musiker, die den Rhythmus gar nicht kennen. In der Musik Bachs finden sich harmonische Farben, eine außergewöhnliche kontrapunktische Arbeit, das ist wunderbar und genial, aber es gibt keinen Rhythmus … man hört in diesen Werken eine ununterbrochene Folge von gleichlangen Dauern, die den Hörer in einen Zustand glücklicher Zufriedenheit versetzen; nichts arbeitet seinem Puls entgegen, seiner Atmung und seinem Herzschlag, er hat also seine Ruhe er erhält keinen Schock, alles dies erscheint ihm wunderbar 'rhythmisch' … [10]
Auch dieser Satz folgt im groben der Form A-B-A’. Eine Melodie B, ausschließlich aus nicht umkehrbaren Rhythmen aufgebaut, bildet zunächst einen deutlichen Kontrast, bald geht sie jedoch wieder in Melodie A über, wird formlos. Ein seltsames Dreitonmotiv f-cis-a wird eingeführt, dessen nicht umkehrbarer Kernrhythmus Achtel-Sechzehntel-Achtel mit ungewöhnlichen Faktoren - 2, 3, 4 und 5 - augmentiert wird. Die so entstandenen Projektionen wirken in der Art eines Katalysators auf Melodie A: Sie löst sich auf in Raserei, in nivellierende Trillerflächen, in Spreizungen, Dehnungen …:
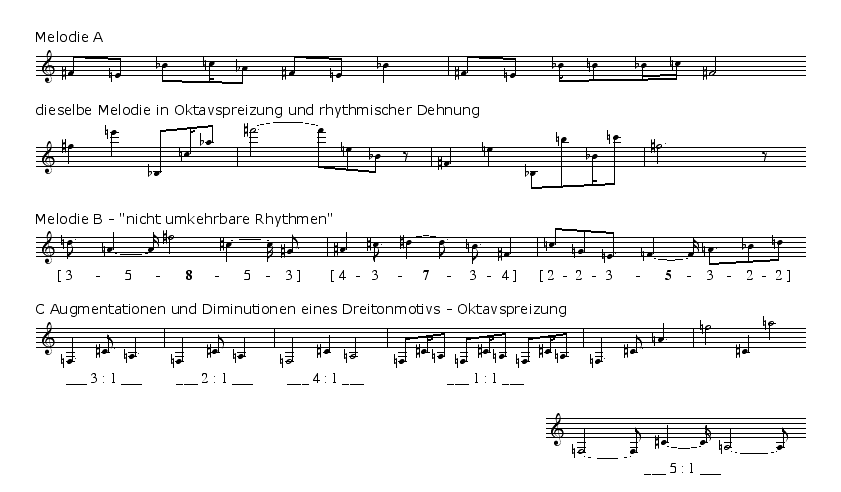
Dem Titel Wirrwarr von Regenbögen für den Engel, der das Ende der Zeit ankündigt entspricht die Struktur des VII. Satzes. Die äußeren Bedingungen des Lageraufenthaltes hinterließen offenbar doch Spuren. Messiaen erinnert sich:
Während meiner Gefangenschaft löste der Nahrungsmangel bei mir farbige Träume aus: Ich sah den Regenbogen des Engels und ein seltsames Kreisen von Farben … [11] Die Musik der Erscheinung des Engels aus dem II. Satz wird wiederholt, allerdings erweitert mit einem weiteren nicht umkehrbaren Rhythmus:
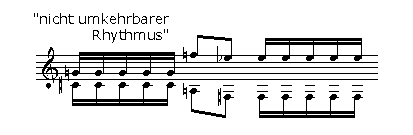
Viermal erklingt ein neuer gregorianischer Gesang, wiederum aus drei Phrasen im Messiaen’schen 2. Modus gebildet, die im Kleinterzabstand zueinander stehen. Zuerst im Violoncello:
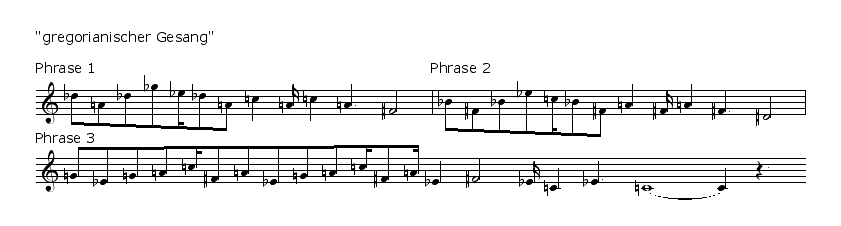
Im Klavier dazu die entsprechenden Komplementärfarben, Akkorde im gleichen 2. Modus, im Kleinterzabstand zueinander angeordnet und bezüglich der Melodie immer im Tritonusabstand - also auf der Gegenseite des Quintenzirkels - stehend:
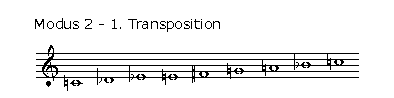
Gegen Ende des Satzes erneut dieser Gesang, jetzt aber ekstatisch getrillert in einem 3-Oktaven-Unisono von Violine, Klarinette und Violoncello - im Klavier in rauschenden Arpeggien dieselben Farbakkorde mit gleißenden Vorschlägen. Messiaen schreibt dazu 1942:
Mein heimliches Verlangen nach feenhafter Pracht in der Harmonie hat mich hingedrängt zu diesen Feuerschwertern, diesen jähen Sternen, diesen blau-orangenen Lavaströmen, diesen Planeten von Türkis, diesen Violettönen, diesem Granatrot wuchernder Verzweigungen, diesem Wirbel von Tönen und Farben in einem Wirrwarr von Regenbögen … [12
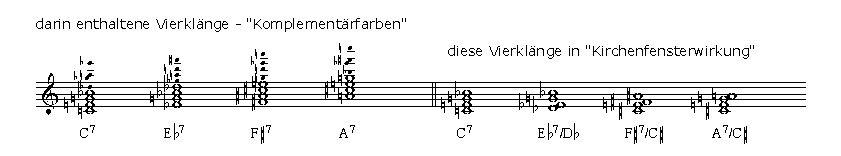
Auch im abschließenden Lobpreis der Unsterblichkeit Jesu gehorcht die unendlich langsame Melodie der Violine (Achtel = 36) dem Prinzip der entwickelnden Variation. In den begleitenden, lombardisch akzentuierten Akkorden des Klaviers dominiert die Farbe des E-Dur-Dreiklangs mit Sixte ajoutée im Sinne Rameaus. Am Ende Entschwinden in der Höhe wie ein umgekehrtes Lohengrin-Vorspiel.
Das apokalyptische
Ende der Zeit erscheint insgesamt also weniger als das Schreckliche, vielmehr
dagegen als eine kosmische Vision, als Anlass zur Begegnung mit wesentlichen
Grundbedingungen menschlichen Daseins. Ende der Zeit als musikalischer
Versuch der Formulierung eines neuen Zeitbegriffs: wiederkehrende Motive
verklammern reminiszenzartig mehrere Sätze, verschiedene Zeitschichten
koexistieren autonom, finale Zeit erweitert sich um zyklische Zeit, Zeit
wird verformt in Dehnung und Stauchung, grenzenlose Zeit in Form ungewöhnlich
langer Töne und extremer Tempi. Theologisch: die Sehnsucht nach Ewigkeit
und Erlösung. Etienne Pasquier, der Cellist der Uraufführung,
notierte im Anschluß auf dem Programmblatt:
Das Lager von Görlitz … Baracke 27B, unser Theater … draußen die Nacht, der Schnee und das Elend … hier, ein Wunder, das 'Quartett für das Ende der Zeit' trägt uns in ein herrliches Paradies, hebt uns aus dieser entsetzlichen Welt - unendlichen Dank unserem lieben Olivier Messiaen, dem Poeten der ewigen Reinheit …[13]
| 1 | Olivier Messiaen: Antwort auf eine Umfrage des Musikkritikers Fred Goldbeck in der Zeitschrift "Contrepoints", März/April 1946 // zurück |
| 2 | in: Claude Samuel (Hrsg.) "Recherche artistique - Hommage à Olivier Messiaen" - Paris 1978, S. 31 // zurück |
| 3 | Olivier Messiaen "Vorwort zur Partitur des Quatour pour la Fin du Temps" - Durand, Paris 1942 // zurück |
| 4 | Olivier Messiaen in: "Conférence de Notre Dame" - Paris 1978, S. 14 // zurück |
| 5 | PRAEMIUM ERASMIANUM MCMLXXI "Discours d’Olivier Messiaen" - Amsterdam 1971, S. 23f. // zurück |
| 6 | Olivier Messiaen "Conference de Bruxelles" - Vortrag, gehalten im Rahmen der Weltausstellung am 15. September 1958 - Leduc, Paris 1960, S. 3 // zurück |
| 7 | a.a.O., S. 4 // zurück |
| 8 | Aloyse Michaely "Die Musik Olivier Messiaens - Untersuchungen zum Gesamtschaffen" - Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft, Sonderband, 1987, S. 407f. // zurück |
| 9 | in: Richard Kostelanetz "John Cage" - Köln 1973 // zurück |
| 10 | in: Claude Samuel "Olivier Messiaen, Musique et Couleur" - Paris 1986 // zurück |
| 11 | in: Claude Samuel (Hrsg.) "Recherche artistique - Hommage à Olivier Messiaen" - Paris 1978, a.a.O. S. 31 // zurück |
| 12 | Olivier Messiaen "Technique de mon langage musical" - Leduc, Paris 1944, Textteil S. 50 // zurück |
| 13 | Th. D. Schlee / D. Kämper (Hrsg.) "Olivier Messiaen: La Cité céleste" - Köln 1998, S. 225 // zurück |